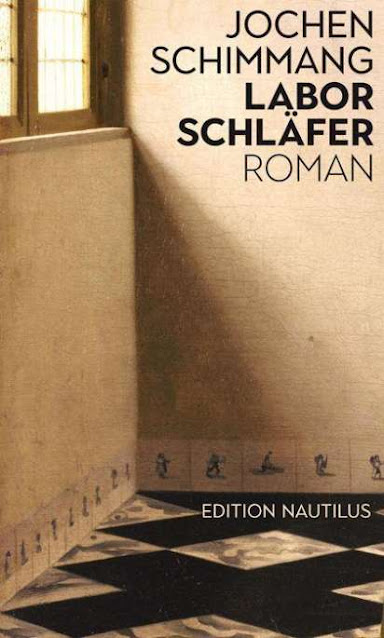Meine kleinen Ausflüge in die ukrainische Literatur standen schnell vor einem Dilemma: Soll ich mich nur um Romane kümmern, die ursprünglich auf Ukrainisch geschrieben sind, oder kann ich auch Werke wählen, die auf dem Territorium der heutigen Ukraine spielen, aber in anderen Sprachen geschrieben sind, zum Beispiel Russisch, Polnisch, Deutsch, und die in dem seit dem 19. Jahrhundert gängigen Modus von Literaturgeschichte der jeweiligen Nationalliteratur zugeschrieben werden?
Mit diesem Thema werde ich mich ein anderes Mal noch auseinandersetzen, jedenfalls habe ich mich entschieden, den auf Russisch geschriebenen Roman „Die Fünf“ (Paris, 1936) von Vladimir Jabotinsky (1880-1940) in meine Auswahl aufzunehmen. Jabotinsky ist ein jüdischer Autor, Journalist und Zionist aus Odessa und hat mit seiner autobiografischen Erzählung über fünf Kinder einer Familie seiner Heimatstadt zu Anfang des 20. Jahrhunderts den wahrscheinlich intensivsten, poetischsten und politischsten Roman über Odessa geschrieben.
Das Buch bekommt erst in allerletzter Zeit die Aufmerksamkeit, die es verdient. Die erste deutsche Übersetzung kam 2012 in einer sehr schönen Ausgabe in „Die andere Bibliothek“ heraus und ist inzwischen als Taschenbuch für 16 € erhältlich (Aufbau Verlag, 2. Auflage 2022, 288 Seiten). Von einer niederländischen Ausgabe ist noch nichts zu sehen.
Die deutschen Rezensionen sind sehr positiv, bleiben aber ziemlich oberflächlich. Das ist halbwegs verständlich, wenn man versucht, sich in die Konstruktion und die Hintergründe von Roman, Autor und Zeitgeschehen hineinzuarbeiten. Von den „Buddenbrooks am Schwarzen Meer“ ist die Rede. Das finde ich nicht einmal übertrieben, nur ist der Jabotinsky von 1935 moderner und damit auch etwas sperriger als die naturalistisch gerundeten und gedehnten und sehr deutschen Buddenbrooks von Thomas Mann aus dem Jahr 1901. Und in all der kosmopolitischen Kultur- und Lebensvielfalt bei Jabotinsky steckt so viel Elend, Gewalt und zukünftiger Polithorror, dass wir die Buddenbrooks ruhig mal in die Ecke stellen können. (Jabotinsky hat zur gleichen Zeit, in der dieses Buch entstand (1935!), umfangreiche Pläne zur freiwilligen Aussiedlung osteuropäischer Juden nach Palästina oder notfalls Madagaskar entwickelt).
Vor Anfang des eigentlichen Romans macht der Autor kurz klar, was er vorhat: eine Erzählung aus seiner Jugend
„mit der Geschichte einer Familie, in der fünf Kinder lebten: Marussja, Marko, Lika, Serjosha und Torik. Ein Teil ihrer Abenteuer spielte sich vor meinen Augen ab; das übrige werde ich, wenn es nötig sein sollte, nach Hörensagen berichten oder nach meinen Vermutungen hinzudichten. Ich verbürge mich nicht dafür, dass ich die Lebensgeschichten der Helden und die Abfolge der allgemeinen Ereignisse in der Stadt oder in Russland, im Rahmen derer all dies geschah, exakt wiedergebe: Die Erinnerung trügt häufig, und für Nachforschungen hatte ich keine Zeit.“
Und genau das tut er: In manchen der episodischen Passagen zum Aufwachsen der fünf Jugendlichen vermengt er Erlebtes, Kolportiertes und Vermutetes, auch das Zeitgeschehen wird aus einer Vermengung von erlebten und später reflektierten Ereignissen berichtet. Zwei großartige Kapitel sind dem dramatischen Auftritt des Panzerkreuzers Potemkin gewidmet (Kapitel 18: Der Potjomkin-Tag und Kapitel 19: Die Potjomkin-Nacht). Viele Leser (und wahrscheinlich auch Jabotinsky) werden den Film von Eisenstein „Panzerkreuzer Potemkin“ von 1925 kennen, und natürlich spielt auch die berühmte Treppe von Odessa, die keiner vergisst, der den Film gesehen hat, in diesem Roman eine Rolle.
Und natürlich gibt es auch eine glücklich-unglückliche und letztlich unerfüllte Liebesgeschichte des Ich-Erzählers (des sich verborgen haltenden Autors) zu Marussja, die wir in zarten, ablehnenden, liebevollen, überhöhten und katastrophalen Phasen miterleben können, wollen und müssen: Wer als Leser am Anfang etwas Probleme mit dem normal-menschlichen Erlebnismodus hat, wird in den poetischen Kapiteln 13, 14 und 15 reichlich entlohnt.
Im Kapitel 25 mit dem Titel „Gomarrha“ hält Torik in einer Nacht mit dem Ich-Erzähler eine lange Rede, in der er den Sinn des Kosmopolitismus und Multikulturalismus von Odessa anzweifelt und für eine abgeschiedene kulturelle Kontinuität der einzelnen Kulturen plädiert:
„In ganz Russland gibt es nirgendwo ein anschaulicheres Bild dieser Unterbrechung der kulturellen Kontinuität als in unserem guten, fröhlichen Odessa. Ich rede nicht nur von den Juden: Das Gleiche geschieht mit den Griechen, mit den Italienern, mit den Polen, sogar mit den Russen – die meisten von ihnen sind eigentlich geborene Ukrainer, sie verkleiden sich nur als Russen; aber am deutlichsten wirkt sich das bei den Juden aus“ (S. 239).
Jabotinskys 1935 geschriebener Roman ist eine Mischung aus Nostalgie und späterer Konsequenz. Er hat viel für die Gründung eines jüdischen Staates getan, ein starker Mann! Vieles davon ist auch verwirklicht worden im Staat Israel, den er nicht mehr erleben durfte. Zunächst kam aber der Holocaust, den er nicht mehr erleben musste.